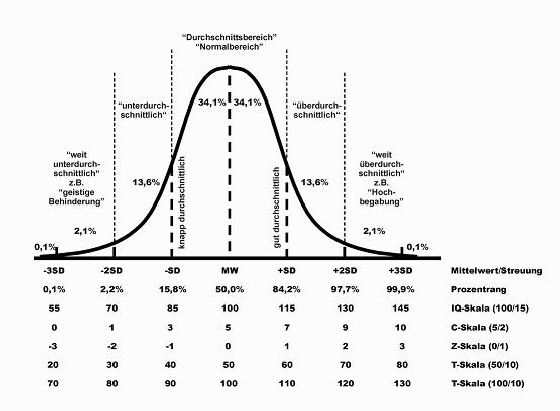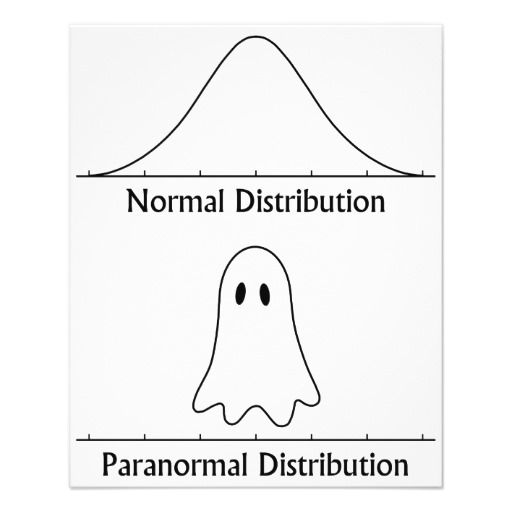Als ich damals einzog, war Söhnchens Papa, der ja überall mit dabei war und mithalf, von der Gegend nicht begeistert, das konnte ich sehen. Aber ich fand die Bleibe für den günstigen Preis geradezu riesig und wollte unbedingt weg. Die bedrückende Situation daheim belastete mich, ich konnte sie nicht ertragen, die Traurigkeit, unser beider Hilflosigkeit. Die Wohnung war günstig, Uni und Krippe gut erreichbar, der Rest war mir egal. "Ist ja nur vorübergehend."
Ich war wild entschlossen, das Beste aus der Situation zu machen. Anfangs kam der Papa noch oft vorbei, aber diese unklare Situation hielt ich auch nicht aus und miteinander reden konnten wir nicht mehr. Und so wurde der Abstand zum Rest der Welt immer größer.
Irgendwann wurde mir klar, wo ich gelandet war. Ich weiß nicht, wann genau mir die Erkenntnis kam, dass ich mich fühlte, wie lebendig begraben. Das Haus war völlig heruntergekommen, die Mitbewohner überwiegend höchst unangenehm und wir waren sozial völlig isoliert.
Während mein Sohn glücklicherweise immer gut aufgehoben war in seiner Krippe und später im Kindergarten, spürte ich unsere soziale Isolation in ihrer gesamten Wucht. Ich gehörte nirgends wirklich dazu: Nicht zu den anderen Studierenden - die waren in der Regel 10 Jahre jünger, wobei das nicht das Entscheidende war. Viel wesentlicher ist es, ein Kind zu haben, während die Kommilitonen im Grunde noch Kinder sind, deren familiäre Sorgen sich bei einem großen Teil noch darum drehen, dass sie am Freitag wenig Lehrveranstaltungen haben, um noch nach Hause fahren zu können.
Meine Probleme bestanden indes darin, einen Platz in den Kursen zu bekommen, die im Rahmen der Betreuungszeiten stattfanden. Und da man als Alleinerziehende nicht bevorzugt werden und sich im Vorfeld für Kurse anmelden darf (wobei es Dozenten gab, denen das egal war und mir einen Platz in ihrem Seminar versprachen - aber eben nur wenige), saß auch ich zu jedem Seminar-Anmeldetermin an meinem Rechner, um wie über 100 Studierende gleichzeitig in der entscheidenden Sekunde den Mausklick auf dem Button zum gewünschten Kurs zu machen. Mit mehr oder weniger Erfolg - aber immer unter maximalem Druck und nicht nur mit Plan B, sondern Plänen B - Z im Ärmel.
An sich kam ich in meinem ersten Semester nach der Trennung mit meinen Kommilitonen nicht gut zurecht. (Erst ganz zum Schluss fand sich eine Kommilitonin, mit der die letzten Monate dort auch wirklich noch schön wurden - bis heute eine liebe Freundin - und ein weiterer Psychologe, der mir auch erhalten geblieben ist). Sie gingen mir auf die Nerven mit ihren Problemchen, die mir nur lächerlich erschienen. Ja, die Einsamkeit brachte Seiten an mir hervor, die ich von mir nicht kannte. Damals war es mir egal. Ich glaube, wenn diese Seiten nicht herausgeholt hätte, hätte ich jeden Tag geheult.
Nun gab es natürlich auch andere Studierende mit Kindern. Aber die hatten ja ihre Partner... genau so, wie später die anderen Mütter im Kindergarten. Ja, klar gibt es Kontakte, aber gelegentliche Treffen alle paar Monate ersetzen nicht das, was einem fehlt, wenn man richtig allein ist. Die Probleme sind meistens auch etwas anders - selbst, wenn es unter diesen einige gibt, die die ganze Woche größtenteils allein sind, weil ihre Männer arbeiten gehen, ist das - entgegen deren eigener Einschätzung - nicht "fast alleinerziehend". Und nein, da schüttet man nur bei den wenigsten (eine gab es, glücklicherweise, und gibt es bis heute...) gern sein Herz aus darüber, wie bescheiden es einem geht.
Ganz abgesehen davon, dass man unheimlich viel Schmerz und Trauer in sich trägt und mit seiner früheren Beziehung eine Menge Probleme am A**** hat.
Wobei ich da noch zu den glücklichen zähle, die zu dem Papa ein recht gutes Verhältnis pflegen. Das war aber im ersten Jahr noch nicht so klar; auch er litt heftig unter der Trennung und ging auf seine eigene Weise damit um; eine Weise, mit der ich massive Probleme hatte und die mir große Sorgen machte. Aber es ging, wir holten uns Hilfe, gaben uns gegenseitig viele, viele Chancen und nun hat es sich gut eingepndelt - ohne seine Unterstützung hätte ich mein Studium an den Nagel hängen können. Aber das erste Jahr war trotzdem furchbar.
Ich suchte also Anschluss und wollte andere Alleinerziehende finden. Einmal ging ich zu einem Treffen eines Vereins - und wusste, dass ich auch da absolut nicht hingehörte. Die Frauen dort waren so... anders. Da war nichts mit einer netten Begrüßung und gegenseitigem Interesse. Ich war froh, als ich wieder weg war.
Tja.
Viel blieb da nicht mehr. Wochenlang waren die einzigen Erwachsenen, mit denen ich ein paar freundliche Worte wechselte - neben den Erzieherinnen beim Bringen und Abholen meines Kindes - die Kassierer/innen im Supermarkt vor der Tür. Ich hatte den Eindruck, dass sie froh waren, mich zu sehen. Schätzungsweise 50% der Klientel dort kamen, um sich mit Zigaretten, Alkohol und Fertiggerichten einzudecken. Zu meinem Sohn waren sie auch immer wahnsinnig nett. Also die Mitarbeiter im Supermarkt.
Die Zeit dort zehrte an mir. Ich war vom Regen in die Traufe gekommen und mir steckten auch noch andere Zeiten in den Knochen; der Tod meines Vaters und die schlechten Beziehungserfahrungen, die ich in meinen Zwanzigern gemacht hatte sowie Traumata aus jener Zeit; Traumata, die ich mir bis dahin nie eingestanden hatte, weil ich mir, wie das mal so ist, selbst die Schuld an allem gab.
Wenn ich heute Bilder von damals anschaue, sehe ich, wie ich verzweifelt versucht habe, meinem Sohn alles so schön wie möglich zu machen. Denn bei allem, was ich damals entbehrte, war das Schlimmste und Tragischste für mich das, was, ich meinem Sohn meinte anzutun. Allein hätte ich es in diesem Ghetto-Haus noch ertragen können. Aber mit diesem kleinen Wesen, das so auf mich angewiesen war, dessen Geschichte der ersten Lebensjahre ich schreiben würde, war es einfach nur schmerzhaft und kaum auszuhalten.
Ich war randvoll mit Trauer: Trauer, weil mein Sohn nicht in der heilen Welt groß werden würde, die wir ihm schenken hatten wollen und auch großer Trauer für seinen Vater und mich. Auch, wenn ich nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte, war ich unendlich traurig für uns beide. Als wir uns trafen, waren wir so glücklich - beide hatten wir vom Leben die totale Breitseite abbekommen und waren voller Hoffnung, gemeinsam zur Ruhe zu kommen... wie bitter wurde diese Hoffnung enttäuscht. Und wir hätten es beide verdient gehabt, unsere Ruhe im Familienglück zu finden. Es war einfach nur furchtbar schwer zu ertragen.
Ja, diese Erinnerungen fühlen sich an wie Blei. Schwer und bedrückend.
Und vor drei Tagen machte ich mich auf den Weg dorthin zurück, um ein Paket abzuholen, das ich versehentlich an die alte Adresse hatte schicken lassen und bei der Gelegenheit dem Hausmeister - der beste der Welt und das einzig Positive an diesem grauenhaften Haus - noch einen Schlüssel zu übergeben.
Danach machte ich einen Spaziergang - einen Weg, den ich früher oft gegangen war, durch einen mit Strommasten gespickten Grünstreifen mit Aussicht auf Schlote, Schnellstraße und Hochhäuser. Ich hörte gerade Musik von Angus & Julia Stone - Musik ist doch immer wieder gut, um ans Innere heranzukommen (darum höre ich in meiner Exil-Zeit eigentlich gar keine Musik!). Die Sonne stand schon tief und alles leuchtete warm. Und da kam es endlich - mir stiegen die Tränen in die Augen; mir wurde klar, dass ich mir auch Leid tun durfte. Nach über einem Jahr Abstand konnte ich endlich auch Mitleid mit mir, Sonja, haben, die sich vier Jahre durchgekämpft hat in ihrem Exil, einsam, traurig, vollkommen überlastet, erschöpft und emotional völlig ausgeblutet.
Ich spazierte an einer Brücke vorbei und sah aus dem Augenwinkel, dass da etwas hingesetzt wurde. Ein kleiner Plüschlöwe, nass und verdreckt. Ich ging hin und wollte ihn fotografieren, weil er, wie er da saß, so sinnbildlich war für die Einsamkeit, an die ich mich gerade erinnerte. Und als ich ihn gerade fotografieren wollt, wurde mir klar, dass ich ihn mitnahm. Und nun ist der Löwe bei uns.
Ein paar Schritte weiter kam dann die Fußgängerunterführung, die mir so vertraut war. Dort sitzen eigentlich immer Obdachlose und einem, der eine Weile immer dort war, hatte ich damals auch immer etwas gegeben. An jedem Tag war keiner da, scheinbar war er kurz weg. Was ich dort aber sah, passte so gut zu meiner emotionalen Lage, zu meinem Thema, dass ich es auch fotografierte - man muss genau hinschauen:
Nun ist das Kapitel endgültig abgeschlossen. Nein, ich hatte kein Bedürfnis danach, noch einmal hineinzugehen oder im Supermarkt vorbeizuschauen und hallo zu sagen. Meine Situation zur Zeit bietet immer noch Luft nach oben, verglichen zu dem, wie andere Familien zusammenleben und was sie sich gönnen können - aber im Vergleich zu damals ist das hier der Himmel. Und immerhin weiß ich jetzt, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein - und dass ich auch das überlebe.